In meinem Blogartikel versuche ich, die Entstehung der Trinitätslehre und das Dogma der Dreieinigkeit zu erklären. Dazu habe ich verschiedene Quellen angefügt, die aufzeigen, wie die Theologie der Dreieinigkeit sich entwickelte und wie sie die Geistesgaben und Geisteswirkungen (Pneuma πνεῦμα und Charisma χάρισμα) aus dem Leben der meisten Christen verdrängt hat.
Zu dem Thema der Geistesgaben und Geisteswirkungen lest bitte auch meine Blogartikel „Die falsche Autorität der Lehrtradition“ und „Prophetie in Deutschland – eine verachtete Gabe des Heiligen Geistes“. Weitere Aspekte der Verdrängung des Heiligen Geistes findet ihr in „Die Herrschaft Christi und die Lehre der Dispensionalisten“ sowie in „Pergamonaltar in Berlin der Thron vom Satan“.
Vorwort
Die wichtigsten Punkte dieses Beitrags sind, dass die Sakramente der katholischen Kirche das Wirken des Heiligen Geistes ersetzen und die priesterlichen Handlungen als einziges Mittel zulassen, um eine weiter undefinierte „göttliche Energie“ („energeiai“ nach Basilius) in einem selbst gewählten Gottesdienst (Kolosser 2:23) zu erfahren.
Da ich als Sektenaussteiger in der Esoterik und im „New Age“ intensive Erfahrungen mit dämonischen und okkulten Energien gemacht habe, wurde ich stutzig, als ich erfuhr, dass die in der Theologie genannte „Energien“ auf die Sakramente übertragen und so von der Kirche als Ausdruck vom Wirken des Heiligen Geistes gesehen wird. In meinem Studium der Theaterwissenschaft habe ich von ganz ähnlichen Konzepten erfahren, die eine Art Mysterium oder Übertragung von Bedeutungen und Zeichen auf der Bühne sehen, so wie sie es die katholische Lehre vom priesterlichen Dienst am Altar behauptet.
Die Deutung von Zeichen in der Performance durch die Theaterwissenschaft
In der Theaterwissenschaft wird Performance als komplexe Zeichenhandlung verstanden, in der physische Gesten, Raumkonstellationen und sprachliche Äußerungen auf der Bühne ein semiotisches Geflecht erzeugen. Erika Fischer-Lichte etwa beschreibt Performance als „kreativen Prozess der Bedeutungsproduktion“, in dem das Publikum mit aktiviert wird und jede Geste zu einem „performativ-signifikanten“ Akt wird, weil sie im Kontext des Theaters eine konventionalisierte Bedeutung erhält.
So wie im Theater, wird in der Kirche das Handeln des Priesters am Altar zur Performance auf einer Bühne (siehe auch meinen Artikel „Die falsche Autorität der Lehrtradition“ zur Erklärung, wie in der Gemeinde ein Publikum geschaffen wird) und bildet durch den aktiven Prozess des Zuschauens ein „Publikum“, das diese Zeichen deutet. Damit wird der Gott, der durch Zeichen und Wunder die Botschaft Jesu bestätigte, zu einem äußerlichen Ritus und letztendlich zu einem stummen Götzen (Habakuk 2,18) gemacht.
Da durch das Konzept und die Theologie der Trinität der Name von Jesus zu einer Randerscheinung gemacht wird, befindet sich der Gläubige in der Kirche nicht mehr in der Autorität und Vollmacht, die Jesus uns geben hat (Lukas 10:19), sondern ist auf die Lehre von einem elitären System von Priestern angewiesen.
Einführung
Die Trinität halte ich für eine falsche Lehre vom Vatikan, mit dem Ziel, die Geisteswirkungen (pneuma) und Geistesgaben (charismata) aus der Kirche zu verbannen, die Lehrhoheit der Kirche zu etablieren und viel Verwirrung unter Christen zu stiften.
Wenn die Trinität als Wort in der Bibel zu finden wäre, dann hätten wir jede Menge Biblelverse, die diesen Begriff oder das Konzept der „Dreieinigkeit“ gebrauchen und bemühen.
Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, damit sie eins sind, so wie wir eins sind.
Johannes 17,11
Niemand konnte jedoch das Wort der „Trinität“ oder den Ausdruck „drei sind eins“ in der heiligen Schrift nachweisen (es sei denn durch einen einzigen, aber umstrittenen Vers im Johannesbrief, den ich gleich noch ausführlich diskutieren werde).
Wenn dieses Konstrukt also nicht so in der Bibel zu finden ist, indem sich mehrere Aussagen von verschiedenen Schriftstellen gegenseitig ergänzen und bestätigen, liegt es daran, dass man es nicht zur Lehre der Bibel zählen darf. Keine der Schriften (außer des einen eben genannten Bibelverses) bezieht sich ausdrücklich auf eine Dreieinigkeit, sondern es ist eine menschliche Interpretation und Deutung, die Spaltung verursacht.
Nehmt euch in Acht vor denen, die Spaltungen hervorrufen und etwas anderes lehren, als was ihr gelernt habt.
Römer 16,17
Wie können wir den Vater im Sohn erkennen?
Selbst Muslime (auch wenn sie einen falschen Gott „Allah“ anbeten) haben verstanden, dass es nur einen Gott gibt und verspotten die Trinität der Christen als „Vielgötterei“. Die Sekte der Zeugen Jehovas lehnt die Lehre der Trinität zwar ab, richtet dabei aber einen großen Schaden an, indem sie die Kraft des Namens von Jesus leugnen.
Jesus sagte: es ist gut, dass ich gehe, sonst würde der Helfer nicht kommen (Johannes 16,7). Der Helfer ist also gekommen, weil Jesus zum Vater gegangen ist und damit wir einen Tröster haben, der uns hilft, unsere geistigen Kämpfe hier in der gefallenen Schöpfung mit der „Stärke von oben“ zu führen. Der Heilige Geist ist dieser Helfer, der von oben kommt.
Der Sohn sitzt zur Rechten des Vaters (Matthäus 26,64) und wird am Ende auch alles an ihn zurück geben, was ihm gegeben ist (1.Korinther 15,24). Trotzdem sind wir als Gläubige Christen mit ihm in himmlische Regionen und eine Position der Autorität versetzt (Epheser 2,6 und 1.Korinther 6,3), wenn wir an seinen Namen glauben.
Die Zeichen aber, die folgen werden denen, die da glauben, sind diese: In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, in neuen Zungen reden, Schlangen mit den Händen hochheben, und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird’s ihnen nicht schaden; Kranken werden sie die Hände auflegen, so wird’s gut mit ihnen.
Markus 16,17-18
Der Name von Jesus hat Kraft
Warum dürfen wir in unseren Gebeten zu Gott in dem Namen von Jesus bitten? Laut Johannes 26,26 können wir dies tun, weil der Vater uns lieb hat und wir Jesus lieben. Wir sollten uns deshalb auch auf den Namen von Jesus Christus taufen lassen, so wie in der Apostelgeschichte beschrieben, denn die Trinität als bloßes Wort oder theologisches Konzept ist nicht der Name Gottes und hat an sich keine Kraft. Der Name von Jesus ist jedoch über allen anderen Namen und hat Kraft (Philipper 2,9-11).
Wir müssen den Vater in Jesus sehen und erkennen (Johannes 14,9). Nur durch den Sohn können wir zum Vater kommen (Johannes 14,6). Dann wird er uns auch den Heiligen Geist geben. Der Heilige Geist ist ein Siegel (laut Epheserbrief 1,13-14), der wie ein Pfand oder Anrecht auf unseren Platz im Himmel gesehen werden kann.
Die Erkenntnis, dass Jesus Gott ist, sehe ich nicht als Doktrin oder Lehre, sondern als eine persönliche Offenbarung (Matthäus 16,17). Es muss wirklich jeder selber erkennen und die Liebe zu Jesus ist dabei der einzige Weg. Ohne ihn können wir nichts tun (Johannes 15,15).
Im Folgenden wollen wir eingehend die als trinitarische Formeln allgemein anerkannten Bibelverse im Matthäusevangelium („Taufformel“) und Johannesbrief („Comma Johanneum“ genannt) untersuchen anhand ihrer historischen und textkritischen Einordnung.
Untersuchungen der Manuskripte zur Trinitätsformel
Das Comma Johanneum bezeichnete ursprünglich einen Satzabschnitt in 1.Johannesbrief 5,7–8, der in späteren lateinischen Übersetzungen als trinitarisches Zeugnis gelesen wurde. Früheste schriftliche Hinweise darauf finden sich nicht in den griechischen Handschriften, sondern tauchten zuerst in der lateinischen Tradition auf. Es gibt Hinweise darauf, dass sich die spezielle Lesart, welche die trinitarische Formel („Vater, Wort und Heiliger Geist sind eins“) enthält, bereits im 4. Jahrhundert in bestimmten lateinischen Predigten und theologischem Schrifttum entwickelte, um die Lehre der Dreifaltigkeit zu untermauern. Diese Formulierung wurde dann nach und nach in den überlieferten lateinischen Texten der Vulgata fest verankert.
Mit dem Aufkommen der humanistischen Textkritik stieß man jedoch auf deutliche Unregelmäßigkeiten: Erasmus fand in den griechischen Handschriften, die er konsultierte, keine entsprechende Passage und weigerte sich zunächst, sie in seine ersten Ausgaben des Neuen Testaments aufzunehmen. Erst als spätere griechische Handschriften – etwa einige späte Minuskeln – den Trinitätsabschnitt auffingen, erschien das Comma Johanneum in gedruckten Texten (beispielsweise in der dritten Ausgabe von Erasmus, 1522). So zeigt sich, dass diese trinitarische Interpolation vermutlich aus der lateinischen Tradition stammte und erst im Laufe der Zeit in den bildungs- und kirchengeschichtlichen Kontext hineingewachsen ist.
Eine Auflistung der Urtexte
Die ältesten griechischen Manuskripte von 1.Johannes 5,7 stammen aus verschiedenen Jahrhunderten, wobei die längere Version mit der Trinitätsformel erst in späteren Handschriften auftaucht:
- GA 629 (1362) – Ein lateinisch-griechisches Manuskript, das die Comma Johanneum enthält.
- GA 61 (frühes 16. Jahrhundert) – Enthält ebenfalls die längere Version.
- GA 918 (1570er Jahre) – Ein weiteres Manuskript mit der Trinitätsformel.
- GA 221 (900er Jahre) – Hier wurde die längere Version später in den Rand geschrieben.
- GA 177 (nach 1550) – Die Trinitätsformel wurde nachträglich hinzugefügt.
- GA 88 (1100er Jahre) – Die längere Version erscheint in der Randbemerkung.
Die ältesten Manuskripte enthalten die kurze Version, ohne „Vater, Wort und Heiliger Geist“. Die längere Version taucht erst in späteren griechischen Handschriften auf, oft als Randnotiz oder nachträgliche Ergänzung.
Urtexte in anderen Sprachen
Es gibt Manuskripte in anderen Sprachen, die 1.Johannes 5,7 enthalten:
- Lateinische Vulgata – Die längere Version taucht ab dem 6. Jahrhundert in lateinischen Handschriften auf.
- Alte Übersetzungen – Frühere Bibelversionen in Syrisch, Koptisch, Armenisch, Äthiopisch, Arabisch und Slawisch enthalten die längere Version nicht.
- Wizanburgensis (8. Jahrhundert) – Eine der frühesten lateinischen Handschriften mit der längeren Version.
- Die Comma Johanneum wurde vermutlich zuerst als Randkommentar hinzugefügt und später in den lateinischen Text übernommen. Erst durch den Textus Receptus fand sie Eingang in einige griechische Manuskripte und Übersetzungen.
Hinweise aus den Schriften der Kirchenväter zur Taufformel
Es gibt einige Hinweise aus den Schriften der frühen Kirchenväter, die darauf hindeuten, dass die trinitarische Taufformel in Matthäus 28,19 möglicherweise später hinzugefügt wurde.
Eusebius von Caesarea (ca. 260–339 n. Chr.)
Eusebius, ein bedeutender Kirchenhistoriker, zitierte Matthäus 28,19 in mehreren seiner Werke, aber oft in einer verkürzten Form:
„Geht hin und macht alle Völker zu Jüngern in meinem Namen.“
Diese Version enthält nicht die Worte „Vater, Sohn und Heiliger Geist“. Interessanterweise stammen seine Zitate aus der Zeit vor dem Konzil von Nicäa (325 n. Chr.).
Nach dem Konzil taucht die vollständige trinitarische Formel in seinen Schriften auf, was einige Forscher als Hinweis darauf sehen, dass die Formel später eingefügt wurde.
Vergleich mit der Apostelgeschichte
In der Apostelgeschichte wird die Taufe immer „auf den Namen Jesu“ vollzogen:
- Apostelgeschichte 2,38 – „Lasst euch taufen auf den Namen Jesu Christi.“
- Apostelgeschichte 10,48 – „Er befahl, sie zu taufen auf den Namen Jesu Christi.“
- Apostelgeschichte 19,5 – „Sie ließen sich taufen auf den Namen des Herrn Jesus.“
Diese Praxis unterscheidet sich von der trinitarischen Formel in Matthäus 28,19, was einige Forscher als Hinweis darauf sehen, dass die ursprüngliche Taufformel möglicherweise nur „auf den Namen Jesu“ lautete.
Textkritische Untersuchungen
Einige Theologen und Historiker argumentieren, dass die trinitarische Formel erst später in den Text eingefügt wurde, um die Lehre der Dreieinigkeit zu stärken. Hier sind einige der bedeutendsten textkritischen Untersuchungen zur Taufformel in Matthäus 28,19:
F.C. Conybeare (1901) war ein britischer Textkritiker und Professor für alte Sprachen. In seiner Analyse stellte er fest, dass Eusebius von Caesarea Matthäus 28,19 mehrfach ohne die trinitarische Formel zitierte, sondern nur „in meinem Namen“. Da Eusebius Zugriff auf sehr frühe Manuskripte hatte, könnte dies darauf hindeuten, dass die vollständige Formel später hinzugefügt wurde.
Karl-Heinz Ohlig (2000) war ein deutscher Theologe und Religionshistoriker. Er argumentierte, dass sich die Trinitätslehre erst über mehrere Jahrhunderte entwickelte und dass die heutige Version von Matthäus 28,19 möglicherweise eine theologische Ergänzung ist, die erst nachträglich in den Text eingefügt wurde.
Die Studie von „Der Bibel Vertrauen“ (2014) untersuchte die Unterschiede zwischen Matthäus 28,19 und den Taufberichten in der Apostelgeschichte. Dort wird die Taufe immer „auf den Namen Jesu“ vollzogen und nicht mit der trinitarischen Formel. Diese Diskrepanz könnte darauf hindeuten, dass die ursprüngliche Taufformel nur „auf den Namen Jesu“ lautete.
Die STA-Forum-Diskussion (2018) basiert auf theologischen Analysen und historischen Quellen. Sie weist darauf hin, dass katholische Gelehrte selbst anerkennen, dass sich die trinitarische Taufformel erst in der frühen Kirche etablierte und möglicherweise nicht zur ursprünglichen Fassung des Matthäusevangeliums gehörte.
Diese Untersuchungen zeigen, dass es keine bekannten griechischen Manuskripte gibt, die Matthäus 28,19 ohne die Trinitätsformel überliefern. Dennoch gibt es theologische und historische Argumente, die darauf hindeuten, dass die heutige Formulierung später in den Text aufgenommen wurde.
Zur Studie von Karl-Heinz Ohlig aus Mainz
Professor für katholische Theologie an der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz und Autor von Ein Gott in drei Personen? (2. Aufl. 2000), Karl-Heinz Ohlig, stellt ausführlich dar, dass das Neue Testament selbst keine ausgeformte Dreieinigkeitslehre kennt. Ihm zufolge hätten sich die späteren Trinitätsformeln vor allem entwickelt, um theologische Positionen nachträglich formal zu legitimieren. Ohne den Missionsbefehl in Matthäus 28,19 und die Taufgeschichte in Markus 1,9–11 wäre niemals eine christliche Dreieinigkeitslehre entstanden – so Ohlig –, doch diese Stellen dienten nur als Anknüpfungspunkte für eine Lehre, deren sachliche Ursachen außerhalb des neutestamentlichen Kanons zu suchen sind.
Sein Hauptargument lautet, dass Mt 28,19 und Mk 1,9–11 formal als Belege herangezogen wurden, obwohl die Intention der ursprünglichen Evangelientexte keine trinitarische Theologie vorgab. Vielmehr zeige das NT in allen übrigen Aussagen keine trinitarischen „Anklänge“, und nur in wenigen Passagen lasse sich allenfalls eine binitarische Entwicklung erkennen. Für Ohlig ist die Taufformel in Matthäus folglich eine spätere redaktionelle Ergänzung, um die bereits extern gewachsene Dreieinigkeitsvorstellung ins Evangelium hinein „rechtlich“ zu verankern.
Von der Theologie der Kirchenväter zur Lehrhoheit der Kirche
Karl-Heinz Ohlig geht in Ein Gott in drei Personen? explizit auf die ursprünglichen Evangelientexte und ihre Verfasser ein: Er zeigt, dass die Schreiber des Neuen Testaments innerhalb eines unitarisch-monotheistischen Horizonts arbeiteten und in den ältesten Handschriften nirgends eine ausgeformte Dreieinigkeitslehre finden. Vielmehr kennt das NT allenfalls vereinzelte, binitarisch auslegbare Erwähnungen, und die bekannten triadischen Formeln standen ursprünglich in keinem direkten Zusammenhang mit einer trinitarischen Dogmatik.
Ohlig legt dar, wie die frühen Kirchenväter – allen voran Irenäus, Tertullian und Origenes – solche Passagen bewusst aufgriffen und theologisch ausbauten, um eine Dreieinigkeitslehre zu konstruieren. Diese Lehre wurde dann auf den Konzilien von Nicäa (325) und Konstantinopel (381) institutionalisiert und dient(e) der Kirche gleichermaßen dazu, innerkirchliche Einheit zu festigen und ihre Lehrhoheit zu legitimieren.
Karl-Heinz Ohlig analysiert die Ausarbeitungen der Kirchenväter Irenäus, Tertullian und Origenes als bewusst gestaltete Schritte hin zu einer dogmatischen Dreieinigkeitslehre, die ursprünglich in den neutestamentlichen Texten so nicht angelegt war.
- Irenäus von Lyon: Ohlig zeigt, dass Irenäus (ca. 130–202) in seinem Hauptwerk Gegen die Häresien die Einheit Gottes betont, aber zugleich eine „ökonomische“ Dreiheit beschreibt, bei der Vater, Sohn und Geist je nach Heilshandeln unterschiedlich auftreten. Für Ohlig ist dieser ökonomische Subordinatianismus kein Beleg für eine ontologische Dreiheit, sondern eine strategische Anpassung an unterschiedliche Gemeindebedürfnisse und Auseinandersetzungen mit hellenistischen Judenchristen.
- Tertullian von Karthago: Ohlig führt aus, dass Tertullian (ca. 155–220) als erster lateinischer Theologe systematisch von drei „Persona“ in einer gemeinsamen „Substantia“ spricht. Dennoch argumentiert Ohlig, dass Tertullians Lehre weiterhin in einem monotheistischen Horizont bleibt und primär dazu diente, gegen monarchianische Tendenzen (rein unitarische Gottessicht) in der Kirche Stellung zu beziehen.
- Origenes von Alexandria: Ohlig hebt hervor, wie Origenes (ca. 185–254) die Beziehung der drei Hypostasen auf die innere Gottheit verlegte: Sein Subordinatianismus nahm die Logik der Einordnung des Sohnes und des Geistes unter den Vater auf und verschob sie ins göttliche Wesen. Für Ohlig ist dies ein wichtiger Schritt, weil hier bereits eine implizite ontologische Differenzierung angedeutet wird, die später formell ausgearbeitet wurde.
Zur Lehrhoheit der Kirche nimmt Ohlig klar Stellung: Er beschreibt, dass Konzile wie Nicäa (325) und Konstantinopel (381) die zuvor heterogenen trinären Reflexionen zu einem verbindlichen Dogma formten, um kirchliche Einheit und Autorität zu stärken. In seinem religionsgeschichtlichen Ansatz argumentiert Ohlig, das Trinitätsdogma sei weniger ein direkt biblisches Vermächtnis als eine kulturgeschichtlich gewachsene Konstruktion, deren normative Verbindlichkeit – und damit die unbedingte Lehrhoheit der Kirche – theologisch neu zu bewerten sei.
Kampf der Theologien
Im Folgenden wollen wir uns im Detail anschauen, wie gewisse Theologien von frühen Kirchenvätern entstanden sind und wie diese in meinen Augen philosophischen Konstrukte zur Theologie der Trinität entwickelt worden sind. Dabei gehe ich exemplarisch zunächst auf die drei Beispiel aus dem Buch von Ohlig ein, die wir vorab schon kurz diskutiert haben.
Recapitulation
Der Begriff der Recapitulation (griech. anakephalaiōsis) wurde von Irenäus eingeführt und bedeutet wörtlich „noch einmal zusammenfassen“. Damit beschreibt er, wie Christus in seinem ganzen Leben und Leiden stellvertretend alle Stufen der Menschheits- und Heilsgeschichte durchläuft und so gewissermaßen „neu aufrollt“ und heilt. Diese Theologie betont, dass Jesus nicht nur stellvertretend am Kreuz stirbt, sondern durch seine Inkarnation, sein Wirken und seine Auferstehung jede Etappe der gefallenen Menschheit in sich aufnimmt und erlöst – ein Kontrast zur gnostischen Lehre, nach der nur das Geistige gerettet werden könne.
Zur Verteidigung der Fleischwerdung Christi
Karl-Heinz Ohlig analysiert die Schriften von Irenäus von Lyon und hebt hervor, dass dieser sich intensiv mit verschiedenen theologischen Strömungen auseinandersetzte, darunter auch mit hellenistischen Judenchristen. Diese Gruppen verbanden jüdische Traditionen mit griechischer Philosophie und entwickelten oft eine stark allegorische Schriftauslegung. Irenäus widersprach solchen Interpretationen, indem er die apostolische Überlieferung als maßgebliche Grundlage der christlichen Lehre betonte.
Besonders in seinem Werk Adversus Haereses argumentierte Irenäus gegen gnostische und spekulative jüdisch-christliche Lehren, die die Einheit Gottes in einer Weise deuteten, die die klare Unterscheidung zwischen Vater, Sohn und Heiligem Geist verwischte. Er verteidigte die Fleischwerdung Christi gegen docetistische Ansätze, die behaupteten, Jesus habe nur scheinbar einen menschlichen Körper besessen. Zudem betonte er die Kontinuität zwischen dem Alten und Neuen Testament, um gegen Lehren vorzugehen, die das jüdische Erbe des Christentums entweder überbetonten oder völlig ablehnten.
Persona und Substantia
Tertullian prägte die Begriffe Persona (Person) und Substantia (Wesen), um die Einheit und Vielfalt Gottes zu erklären. Unter Substantia versteht man die eine göttliche Essenz, das gemeinsame göttliche „Sein“, das nur einmal existiert. Die Persona bezeichnet jede der drei unterscheidbaren Personen (Vater, Sohn, Heiliger Geist), die jeweils in dieser einen Substanz existieren. Mit dieser Unterscheidung bekämpfte Tertullian modalistische Lehren, die Gott nur in wechselnden „Modi“ (Vater heute, Sohn gestern usw.) vorgaben, und sicherte die reale Unterscheidbarkeit der göttlichen Personen.
Bewahrung der Einheit Gottes gegen Adoptianismus und Modalismus
Tertullian setzte sich in seinem Werk Adversus Praxean intensiv mit dem Monarchianismus auseinander, einer theologischen Strömung, die versuchte, die Einheit Gottes durch eine strikte monotheistische Sichtweise zu bewahren. Dabei gab es zwei Hauptformen:
- Dynamischer Monarchianismus (Adoptianismus) Diese Lehre besagte, dass Jesus Christus ursprünglich nur ein Mensch war und erst später von Gott als Sohn „adoptiert“ wurde. Vertreter wie Theodotus von Byzanz (ca. 190 n. Chr.) argumentierten, dass Christus bei seiner Taufe mit göttlicher Kraft ausgestattet wurde, aber nicht von Natur aus göttlich war.
- Modalistischer Monarchianismus (Modalismus oder Patripassianismus) Diese Richtung behauptete, dass Vater, Sohn und Heiliger Geist keine eigenständigen Personen seien, sondern lediglich verschiedene „Modi“ oder Erscheinungsweisen des einen Gottes. Das bedeutete, dass Gott Vater selbst in der Gestalt des Sohnes am Kreuz gelitten habe – eine Ansicht, die als Patripassianismus bekannt wurde.
Tertullian widersprach beiden Ansätzen vehement. Gegen den Adoptianismus argumentierte er, dass Christus von Anfang an göttlich war und nicht erst später „angenommen“ wurde. Gegen den Modalismus setzte er seine berühmte Formel „tres personae, una substantia“ (drei Personen, eine Substanz), um klarzustellen, dass Vater, Sohn und Heiliger Geist zwar eine göttliche Wesenheit teilen, aber dennoch real voneinander unterscheidbar sind.
Subordinationistisches Modell
Der Subordinationismus, wie ihn Origenes vertrat, ordnet Sohn und Geist dem Vater in einer Hierarchie unter. Er lehrte, der Sohn sei ewig „gezeugt“ aus dem Vater und der Geist sei wiederum vom Sohn ausgegangen. Diese „Unterordnung“ (Subordination) im inneren Leben Gottes ist keine Abwertung, sondern eine Beschreibung ihrer Beziehung: Der Vater bleibt die höchste Quelle, während Sohn und Geist daraus hervorgehen. Später wurde dieses Modell weiterentwickelt, bis die Konzile eine Gleichordnung aller drei Personen als Dogma festschrieben.
Die philosophische Einführung einer ontologischen Differenzierung
Karl-Heinz Ohlig argumentiert, dass Origenes eine ontologische Differenzierung innerhalb Gottes einführte, die später zur formalen Trinitätslehre führte. Während frühere Theologen wie Irenäus und Tertullian eine „ökonomische Dreiheit“ betonten – also eine Unterscheidung der göttlichen Personen basierend auf ihrem Heilswirken –, verlagerte Origenes diese Differenzierung in das göttliche Sein selbst.
Origenes lehrte, dass der Sohn ewig aus dem Vater hervorgeht und der Geist wiederum vom Sohn ausgeht. Diese Vorstellung eines inneren Subordinatianismus bedeutete, dass der Vater die höchste Quelle bleibt, während Sohn und Geist ihm ontologisch untergeordnet sind. Diese Differenzierung war zunächst nicht als absolute Gleichordnung gedacht, sondern als eine Art Rangfolge innerhalb der Gottheit. Später wurde diese Idee weiterentwickelt und auf dem Konzil von Nicäa (325) durch die Formel homoousios („wesensgleich“) ersetzt, um die volle Gleichheit von Vater und Sohn zu betonen.
Die nachfolgenden theologischen Debatten führten schließlich zur dogmatischen Festlegung der Trinität auf dem Konzil von Konstantinopel (381), wo auch der Heilige Geist als gleichwesentlich mit Vater und Sohn anerkannt wurde. Damit wurde die ursprüngliche Differenzierung von Origenes in eine endgültige Gleichordnung überführt.
Entwicklung der Theologie zum Dogma
Das subordinationistische Modell, das Origenes formulierte – wonach der Sohn und der Geist dem Vater ontologisch untergeordnet sind –, wurde zunächst von seinem Schüler Dionysius von Alexandria weitergetragen. In der Folge griff Arius diese Logik auf und entwickelte sie zum Arianismus, der Christus als geschaffenes Wesen betrachtete, das nur dem Vater untergeordnet sei.
Dagegen erhob Athanasius von Alexandria in seinen Streitschriften die Wesensgleichheit (griech. homoousios) von Vater und Sohn zum zentralen Argument und stellte damit erstmals eine scharfe Gegenthese zum Subordinationismus auf. Schließlich schufen die kappadokischen Väter – Basilius der Große, Gregor von Nazianz und Gregor von Nyssa – eine systematische Unterscheidung zwischen Ousia (Wesen/Substanz) und Hypostase (Einzelperson). Mit dieser Terminologie begründeten sie die Ko-Existenz und Ko-Ewigkeit aller drei göttlichen Personen, ohne ihren unitarischen Monotheismus aufzugeben.
Auf dem Ersten Konzil von Nicäa (325) wurde unter Kaiser Konstantin die Wesensgleichheit (homoousios) von Vater und Sohn feierlich als verbindliches Dogma proklamiert und der Arianismus als häretisch verurteilt. Das Konzil von Konstantinopel (381) ergänzte das Glaubensbekenntnis um die volle Gleichordnung des Heiligen Geistes und formulierte so die Taufformel in drei gleichwertigen Personen.
Mit diesen Beschlüssen übte die Kirche ihre Lehrhoheit aus, indem sie alle subordinationistischen und modalistischen Auffassungen als unvereinbar mit dem orthodoxen Glaubensbekenntnis ausschloss.
Die Trinitätslehre in Verbindung mit der Sakramententheologie
Augustinus verknüpft in „De sacramentis“ (419) die trinitarische Lehre eng mit einer geordneten Sakramententheorie, indem er Sakramente als von Christus gestiftete, sichtbare Zeichen versteht, die durch den Heiligen Geist zuverlässig und unabhängig von spontanen Geistesereignissen wirksam werden („ex opere operato“). Damit rückt er unvorhersehbare Charismata in den Hintergrund: Nicht spontane Prophetie, Heilung oder Zungenrede stehen im Zentrum, sondern die fest etablierten liturgischen Riten als primäre Kanäle göttlicher Gnadengaben.
Papst Gelasius I. sah in unkontrollierten „Geistesausbrüchen“ eine Bedrohung für die kirchliche Einheit und Disziplin. In seinem Brief an Kaiser Anastasios (494) betont er, dass allein die geordneten Bischöfe und Priester befugt seien, die „ehrwürdigen Mysterien“ zu verwalten und zu schützen. Durch die Hervorhebung der sacra potestas des Episkopats gegenüber der weltlichen Macht wollte er sicherstellen, dass keine häretischen oder zerreißenden Offenbarungsbehauptungen die kirchliche Lehre und Sakramentspraxis untergraben.
Die Kirche in ihrer geistlichen Hoheit
Papst Gelasius I. formulierte in seinem Brief an Kaiser Anastasios I. (494 n. Chr.) die sogenannte Zwei-Gewalten-Lehre, die das Verhältnis zwischen weltlicher und geistlicher Macht regelte. Er argumentierte, dass Gott zwei Gewalten zur Leitung der Welt eingesetzt habe: die kaiserliche Gewalt (regalis potestas) und die geistliche Autorität der Bischöfe (auctoritas sacrata pontificum). Dabei betonte er, dass die geistliche Autorität über der weltlichen stehe, da die Bischöfe vor Gottes Gericht auch für die Könige Rechenschaft ablegen müssten.
Gelasius begründete die alleinige Verwaltung der „ehrwürdigen Mysterien“ durch die Kirche mit der besonderen Verantwortung der Priester für das Heil der Seelen. Er schrieb, dass der Kaiser zwar über das Menschengeschlecht gesetzt sei, aber dennoch den Vorstehern der göttlichen Dinge fromm den Nacken beugen müsse und von ihnen die Mittel seines Heils erwarte. Diese Argumentation zielte darauf ab, die kirchliche Unabhängigkeit gegenüber kaiserlichen Eingriffen zu sichern und die geistliche Hoheit über die Sakramente und die Glaubenslehre zu festigen.
Das Konzept der sacra potestas des Episkopats bedeutet, dass die Bischöfe eine göttlich verliehene Autorität besitzen, die nicht von weltlicher Macht abhängt. Diese geistliche Gewalt umfasst die Verwaltung der Sakramente, die Verkündigung der Lehre und die Disziplinargewalt innerhalb der Kirche. Gelasius stellte klar, dass die Bischöfe nicht nur für die Gläubigen, sondern auch für die Herrscher verantwortlich seien, da sie über das ewige Heil wachen. Diese Lehre wurde später von Päpsten wie Gregor VII. weiterentwickelt und spielte eine zentrale Rolle in den mittelalterlichen Auseinandersetzungen zwischen Kirche und Staat.
Verdrängung der Gnadengaben und Geiteswirkungen durch die Lehre der Trinität
Augustinus verband in seinen Schriften, insbesondere in „De sacramentis“ und „De Trinitate“, die Dreifaltigkeitslehre eng mit der sakramentalen Praxis. Für ihn waren die Sakramente nicht bloß symbolische Rituale, sondern wirkungsvolle Zeichen, die das göttliche Wirken – die Gnadenübertragung – unmittelbar bezeugen. Er vertrat die Ansicht, dass gerade in der Ordnung des heiligen Handelns die Wahrheit der Trinität gegenwärtig wird. Das heißt, in jedem Sakrament manifestiert sich das Wirken des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Durch das Prinzip „ex opere operato“ betonte Augustinus, dass die sakramentale Wirkung unabhängig von subjektiven, oft unvorhersehbaren charismatischen Erfahrungen zustande kommt. Die Sakramente vermitteln damit nicht nur eine unmittelbare, persönliche Begegnung mit der göttlichen Gnade, sondern sie legen auch die Grundlage für die kirchliche Autorität, indem sie eine festgelegte, überliefertes und normatives Handeln gewährleisten.
Diese systematische sakramentale Theologie verlieh der fest formulierten Trinitätslehre weitreichende Bedeutung und führte dazu, dass die früheren, oft dynamischeren Auslegungen der pneumatologischen Gnadengaben – wie sie etwa in den Traktaten der Cappadokischen Väter und insbesondere bei Basilius dem Großen verbreitet waren – in den Hintergrund gerieten. Basilius hatte das Wirken des Heiligen Geistes als ungeschaffene Energien (energeiai) beschrieben, die vielfältige, oft spontane Gnadengaben in die Gemeinde bringten. Mit Augustinus’ Ansatz jedoch wurde das unvorhersehbare Wirken der Charismata durch eine fest installierte sakramentale Ordnung ersetzt, in der Gottes Wirken institutionell und beständig gesichert war. Somit trug die Betonung der Trinitätslehre in Verbindung mit einer stabilisierten Sakramentstheologie dazu bei, dass die eher flüchtigen, individuellen Pneuma-Erlebnisse und frei auslaufenden Charismen zugunsten einer geordneten, von der Kirche kontrollierten Praxis verdrängt wurden.
Die Umdeutung des Heiligen Geistes auf die Rituale der Kirche
Wie wir gesehen haben, treten im Laufe der Kirchengeschichte und der theologischen Debatten (der Aufbau der geistigen Festungen, 2.Korinther 10,4) anstelle der Kraft des Namens Jesu und der Wortverkündigung, wie sie die Bibel lehrt, die Sakramente mit ihrem rituellen Charakter. Damit wird die Demonstration der Geistesgaben erfolgreich an den Rand gedrängt. Der Erweis von Gottes Kraft (1.Korinther 2,4) wird auf die Riten und Lehrhoheit der Kirche abgetreten.
Indem Gott in drei Personen aufgespalten wird, ohne diese weiter zu charakterisieren, entsteht plump gesagt ein kraftloser Einheitsbrei und der Name Jesus kann mit Leichtigkeit durch rituelle Handlungen ersetzt werden, denen per se eine Kraft („ex opere operato“) zugesprochen wird: die Sakramente werden als sichtbare Zeichen der unsichtbaren Trinität gesehen.
Somit wird der Name von Jesus und die Beziehung zum Vater überschrieben mit einer Theologie, die das Evangelium ablöst. Es wird nicht mehr die frohe Botschaft gepredigt, die Gott durch Zeichen und Wunder bestätigen kann, sondern ein äußerlicher Gottesdienst abgehalten.
Dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Von solchen wende dich ab!
2.Timotheus 3,5
In der Kirchengeschichte wird der Heilige Geist und seine Kraft, wie sie die Bibel beschreibt, durch eine „allgemeine“ Trinität ersetzt, die laut Augustinus wie eine esoterische Energie wirkt, indem sie sich in der Sakramentenlehre auf die Dinge und Handlungen überträgt.
Darin kam ich als Sektenaussteiger und ehemaliger Esoteriker die Manifestation von Luzifer persönlich erkennen, der sich als Engel des Lichts kleidet. Der Ursprung der Dreineinigkeitslehre ist nirgendwo anders, als in der Kirche zu finden und in dem verbindlichen Glaubensbekenntnis orthodoxer Tradition. Lasst uns die wahre Lehre der Bibel finden und aufspüren, worin die rechte Erkenntnis Gottes liegt.
Die drei Zeugen für Jesus Christus: das Wasser, das Blut und der Heilige Geist
Das Geheimnis der Einheit von Vater und Sohn bedarf keiner sachlichen Erklärung mit Begriffen, die von der Theologie und der Tradition einer antichristlichen Kirche kommen. Warum sollten wir Begriffe wie „Dreieinigkeit“ überhaupt in den Mund nehmen, wenn Jesus selbst zu Petrus sagte: „nicht Fleisch und Blut haben dir das offenbart“ (Matthäus 16:17).
Vergeblich aber verehren sie mich, weil sie Lehren vortragen, die Menschengebote sind.
Matthäus 15,9
Es ist eine Offenbarung, die von Gott selbst und individuell gegeben wird, nicht von einer Theologie oder menschlichen Lehre, die sich auf den Intellekt, der aus Fleisch und Blut ist, verlässt.
| Übersetzung | Text von 1. Johannes 5:7 | Enthält „Vater“? |
| Lutherbibel (bis 1912) | „Denn drei sind, die da zeugen im Himmel: der Vater, das Wort und der Heilige Geist; und diese drei sind eins.“ | ✅ Ja |
| King James Version (KJV) | „For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost: and these three are one.“ | ✅ Ja |
| Schlachter 2000 | „Denn drei sind, die Zeugnis ablegen im Himmel: der Vater, das Wort und der Heilige Geist; und diese drei sind eins.“ | ✅ Ja |
| Elberfelder Bibel (kritischer Text) | „Denn drei sind es, die Zeugnis ablegen.“ | ❌ Nein |
| Nestle-Aland (kritischer Text) | „Denn drei sind es, die Zeugnis ablegen.“ | ❌ Nein |
| Neue Genfer Übersetzung | „Denn drei sind es, die Zeugnis ablegen.“ | ❌ Nein |
Ich bin nach eingehender Beschäftigung mit dem Thema „Trinität“ der Meinung, dass der Vers im Johannesbrief, wie nun ausführlich diskutiert worden ist, nachträglich hinzugefügt wurde. Die Aussage an sich wäre nicht falsch, aber sie ist auch an dieser Stelle des Briefes verwirrend. Es wird von drei Zeugen geredet: Wasser, Blut und Geist. Darauf sollte der Fokus sein. Ich höre kaum jemanden darüber predigen, wie der Geist, das Blut und das Wasser als Zeugen für Jesus zu sehen sind.
| Übersetzung | Gute Nachricht Bibel 2018 | Elberfelder Bibel | Neues Leben. Die Bibel | Schlachter |
| 1.Johannes 5,6 | Dieser ist es, der gekommen ist durch Wasser und Blut: Jesus Christus; nicht im Wasser allein, sondern im Wasser und im Blut. Und der Geist ist es, der ⟨dies⟩ bezeugt, denn der Geist ist die Wahrheit. | Jesus Christus kam zu uns mit dem Wasser seiner Taufe und mit dem Blut seines Todes. Er kam nicht allein mit dem Wasser, sondern mit Wasser und mit Blut. Der Geist bezeugt dies, und der Geist sagt die Wahrheit. | Jesus Christus wurde durch die Taufe im Wasser und durch sein Blut am Kreuz als Sohn Gottes offenbart – nicht nur durch Wasser, sondern durch Wasser und Blut. Und auch der Geist bestätigt uns das, denn der Geist Gottes ist die Wahrheit. | Er ist es, der durch Wasser und Blut gekommen ist, Jesus der Christus; nicht durch Wasser allein, sondern durch Wasser und Blut. Und der Geist ist es, der Zeugnis gibt, weil der Geist die Wahrheit ist. |
| 1.Johannes 5,7 | Es gibt also drei Zeugen: | Denn es sind drei, die ⟨es⟩ bezeugen: | Wir haben also diese drei Zeugen – | Denn drei sind es, die Zeugnis ablegen im Himmel: der Vater, das Wort und der Heilige Geist, und diese drei sind eins; |
| 1.Johannes 5,8 | den Geist, das Wasser und das Blut. Die Aussagen dieser drei Zeugen stimmen überein. | der Geist und das Wasser und das Blut; und die drei sind einstimmig. | den Geist, das Wasser und das Blut –, und alle drei sagen dasselbe. | und drei sind es, die Zeugnis ablegen auf der Erde: der Geist und das Wasser und das Blut, und die drei stimmen überein. |
Die drei Verse im ersten Johannesbrief übersetzen Schlachter und Luther auch noch so, dass die drei Zeugen „im Himmel“ das Zeugnis ablegen, aber es geht doch bei den Zeugnissen darum, dass wir auf dieser Erde Aussagen über Jesus haben können, die bestätigen, dass er von Gott kommt.
Die Gotteserkenntnis in dem Sohn Gottes
Macht es denn überhaupt Sinn, im Himmel Bestätigung dafür zu haben, dass Jesus wirklich von Gott kam, wenn wir hier auf der Erde sind? Jesus legte aber auf dieser Erde, als er hier in Fleisch und Blut kam, Zeugnis von sich selbst ab. Die Pharisäer glaubten Jesus nicht, denn sie sagten »Du legst Zeugnis über dich selbst ab: dein Zeugnis ist ungültig.« (Johannes 8,13). Doch er erwiderte: »Weder mich noch meinen Vater kennt ihr; wenn ihr mich kenntet, würdet ihr auch meinen Vater kennen.« (Johannes 8,19). Damit sagt er in anderen Worten, dass der Vater mit ihm zusammen Zeugnis gibt, weil er eins mit dem Vater, also Gott in ihm ist (und Gott mit uns).
Die Werke selbst, die ich tue, zeugen von mir, dass der Vater mich gesandt hat.
Johannes 5,36
Wir können also auf dieser Erde und heute noch Bestätigung haben, dass Jesus in uns ist, wenn er unseren Glauben durch Zeichen und Wunder bestätigt, wie eingangs in Markus 16,17-18 erwähnt. Diese Zeichen, die jene begleiten, die da glauben, sind die Zeugen, durch die der Geist bestätigt, dass wir wirklich in der Autorität von Jesus sind.
Diese Werke aber, die der Heilige Geist tut, hat die Kirche durch eine Dreifaltigkeitslehre unterbunden und getötet, damit sie einen Zeugen weniger haben, der den Herrn als unseren ewigen Gott bestätitgt.
Und man nennt seinen Namen: Wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens.
Jesaja 9,5
Die ganze Bibel ist voll von Aussagen, wer Jesus ist. Eine der prophetischen Schriften sagt: sein Name soll sein „Immanuel“ (Jesaja 7,14), das ist „Gott mit uns“, das Evangelium sagt: das Wort wurde Fleisch und das Wort war Gott (Johannes 1,1). Diese Gotteserkenntnis haben schon immer diverse Leute stehlen wollen und als sie Gott erkannten, leugneten sie ihn.
Deshalb gibt es so viele, die zu Jesus noch „Jehova“ hinzufügen oder einen „Yeshua“ daraus machen wollen, aber nicht besser sind als sogenannte „Trinitarier“ und „Unitarier“. Sie haben die Einheit Gottes („Gott ist einer“). verlassen und so auch keine rechte Gotteserkenntnis durch unseren Herrn und Erlöser. Sie sind spitzfindigen Lehrern auf den Leim gegangen. Das hebräische „echad“ in Deuteronomium 6,4 („יְהוָה֙ ist einer“) meint eine Einheit, nicht „ein Einzelner“. Dasselbe Wort wird in Genesis 2,24 gebraucht: „… und sie werden ein Fleisch sein“ (hebr. basar echad). Lasst und weiter forschen, wie sich die Einheit von Vater und Sohn wirklich in der Bibel offenbart, worauf vor allem im Johannesevangelium („Ich und mein Vater sind eins“) der Schwerpunkt liegt.
Warnungen vor falschen Lehrern in der Bibel
Ihr habt den Schlüssel der Erkenntnis weggenommen. Ihr selbst seid nicht hineingegangen und habt auch denen gewehrt, die hineinwollten.
Lukas 11,52
Genauso (…) werden auch unter euch falsche Lehrer auftreten, die gefährliche Irrlehren verkünden.
2.Petrus 2,1
In den letzten Tagen werden manche vom Glauben abfallen und sich an Irrgeister und an die Lehren von Dämonen halten, an die Lehren von Leuten, die sich verstellen und die Wahrheit verdrehen, die ein Brandmal im eigenen Gewissen tragen.
1.Timotheus 4,1-3
Jeder, der etwas anderes lehrt als die guten Worte von Jesus Christus, unserem Herrn, und nicht an der Lehre festhält, auf der unser Leben im Glauben beruht, der ist verblendet und unwissend.
1.Timotheus 6,3-4
Sie haben Gottes Wahrheit in Lüge verkehrt und das Geschöpf verehrt und ihm gedient statt dem Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit.
Römer 1,25
2. Timotheus 4:3-4
Denn wir sollen nicht mehr Unmündige sein, hin- und hergeworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre durch die Betrügerei der Menschen, durch ihre Verschlagenheit zu listig ersonnenem Irrtum.
Epheser 4,14
Binität statt Trinität
Ich denke, dass die Trinität höchstens eine katholische Lehre ist, die durch die Ökumene und von diversen Kirchenverbänden, wie dem Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden (BEFG/Baptisten), in Form von Glaubensbekenntnissen verbindlich gemacht worden ist, von Menschen geschrieben.
In Johannes 3,16 zum Beispiel, den manche Christen als trinitarischen Vers lesen wollen, sehe ich keine Trinität, sondern eine Binität: „darum hat Gott (1) so die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn (2) gab“, da ist keine Trinität drin. Und auch wenn bestimmte Leute die Trinität in Johannes 1,1 sehen, so steht dort nur: „das Wort (1) war Gott (2)“, also wieder nur eine Binität, keine Trinität.
Und davon reden wir auch, nicht in Worten, die von menschlicher Weisheit gelehrt sind, sondern in solchen, die vom Heiligen Geist gelehrt sind, indem wir Geistliches geistlich erklären.
1.Korinther 2,13
Das Wort der Trinität ist lateinisch und ich wage ich zu behaupten, dass allein an dem lateinischen Begriff eine falsche Lehre vom Vatikan zu erkennen ist, der diese Theologie dazu gebraucht hat, um die Lehrhoheit der Kirche zu festigen und aus den Sakramenten ein Dogma zu machen.
So wurde der Heilige Geist erfolgreich auf das Handeln der Priester umgedeutet und die Zeichen und Wunder aus der Kirche verbannt. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass die meisten Christen, die die Lehre der Trinität verteidigen, auf der anderen Seite die Geistesgaben und die Kraftwirkungen des Heiligen Geistes verleugnen und auch keine Zungenrede in ihrem Gebetsleben zulassen.
Ich bringe falsche Gedankengebäude zum Einsturz und reiße den Hochmut nieder, der sich der wahren Gotteserkenntnis entgegenstellt.
2.Korinther 10,4-5
Glaubensbekenntnisse und menschliche Weisheit
Es gibt noch einen weiteren interessanten Aspekt in der Kirchengeschichte, nämlich den Ursprung des Glaubensbekenntnisses (orthodox und apostolisch), den wir direkt in der Lehre der Dreieinigkeit finden können.
Wer diesen Worten etwas hinzufügt, dem wird Gott die Qualen zufügen, die in diesem Buch beschrieben sind.
Offenbarung 22,18
Ich sehe eine unmittelbare Gefahr, ein verbindliches Glaubensbekenntnis, dessen Ursprung theologisch gesehen in der Mystik der hellenistischen Götterwelt und Philosophie der Heiden liegt, in einer christlichen Versammlung zu rezitieren. Es ist nicht verwerflich, wenn es aus Unkenntnis geschieht, aber sobald man Erkenntnis erlangt hat, sollte man von jeglicher Philosophie Abstand nehmen, die in dem Kolosserbrief sogar als „leerer Betrug“ bezeichnet wird.
Seht zu, dass euch niemand einfange durch die Philosophie und leeren Trug, die der Überlieferung der Menschen (…) und nicht Christus.
Kolosser 2,8
Wir reden allerdings Weisheit unter den Gereiften; aber nicht die Weisheit dieser Weltzeit, auch nicht der Herrscher dieser Weltzeit, die vergehen,
1.Korinther 2,6
Aus den nun vorher diskutierten geschichtlichen Hintergründen wissen wir, dass es sich bei der „Dreieinigkeit“ wohl um die Weisheit von diesen Herrschern der Weltzeit handelt, von denen Paulus im ersten Brief an die Korinther spricht. Diese haben nicht aus dem Geist Gottes heraus königlich einberufene Konzile veranstaltet und Glaubensbekenntnisse festgelegt, sondern aus Gründen der Regierung, fast wie durch das Wirken von geistlichen Geheimdiensten.
Ich finde, wir sollten wir uns von jeglichem Gottesdienst fern halten, in der wiederholende Gebete gesprochen werden. Die Glaubensbekenntnisse der Kirchen aber kommen solchen wiederholen Gebeten gleich, von denen Jesus uns abbringen will und kann. Beschäftigt man sich mit dem Ursprung aller Glaubensbekenntnisse, wird man am Ende feststellen, dass der Vatikan als erstes ein verbindliches Glaubensbekenntnis formulierte, nicht aus einem Reden des Heiligen Geistes, sondern aus einem Konkurrenzdenken gegen geistige Strömungen, die dem Papsttum die Herrschft streitig machten.
Die Instrumentalisierung der Trinitätsdoktrin
Wie wir eben heraus gefunden haben, gibt es historisch dokumentierte Bestrebungen, eine geistige Herrschaft über Ländergrenzen hinweg auszuüben und zum Original der Bibel weitere Schriften und Auslegungen hinzuzufügen, sowie Rituale einzuführen, die eine bestimmte geistige Identität erschaffen, die unverwechselbar und unangefochten bleiben will.
Vor diesem Hintergrund behaupte und glaube ich, dass sehr wohl die Möglichkeit besteht, das die Originalschriften der Bibel unbemerkt oder im Geheimen verändert worden sind, um eine bestimmte geistige Identität aufzubauen. Auch wenn ich die Autorität der Bibel hundertprozentig anerkenne, sehe ich doch triftige Hinweise, das die Trinitätslehre womöglich das Hauptanliegen der geistigen Herrschaft des Vatikan war, um die Schrift zu manipulieren.
Schauen wir uns mal praktisch an, was passiert, wenn wir den Gedanken zulassen, dass die Taufformel im Matthäusevangelium nachträglich in die Manuskripte eingefügt worden ist. Damit ist der alleinige Name von Jesus entfernt worden, die Trinität und die Lehrhoheit der Kirche konnte durch die exklusive und elitär organisierte Auslegung der Schrift gefestigt werden. Schließlich konnte über die Festlegung der Sakramente das spontane und unvermittelte Wirken des Heiligen Geistes aus der Kirche verbannt werden.
Lasst uns weiter auf die Trinitätsformel im Johannesbrief blicken. Welchen Zweck erfüllt das Zeugnis geben im Himmel gegenüber den Zeugnissen Gottes, die wir hier auf der Erde haben können? Wenn „der Vater, das Wort und der Geist“ wirklich im Himmel Zeugnis geben würden, wie sähe das aus? Welche Schrift bestätigt das? Im Himmel haben die Menschen nichts von solchen Zeugnissen, denn wir leben hier auf der Erde.
Und so zieht mein Volk umher wie eine Schafherde und leidet, weil es keinen Hirten hat.
Sacharja 10,2
Durch eine nachträgliche Einfügung dieser Trinitätsformel hat die Kirche eine Legitimation für ihre priesterlichen Handlungen bekommen, die dem Geist Gottes, wie Paulus sein Wirken im Korintherbrief beschreibt, kaum mehr Raum geben. Die Priester mit ihren rituellen Handlungen allein geben nun Zeugnis von dem sichtbaren Wirken einer Trinität, die als Zeichensprache (wie im Theater als Performance) erscheint.
Meine Überzeugung ist, dass wir uns auf den Namen von Jesus taufen lassen sollten, der bei der Taufe auch ausgesprochen werden muss. Denn es gibt nur einen Namen, mit dem wir gerettet werden können (Apostelgeschichte 4,12). Ebenso glaube ich, dass die drei Zeugen, das Wasser, das Blut und der Geist eindeutige Zeichen sind, die vielfach in der Bibel als Gottes eigene Sprache bestätigt werden, wie er mit uns Menschen seinen Bund schließen will. Auf diese Zeugen spricht der erste Johannesbrief an der Stelle an. Die Trinität des „Comma Johanneum“ dagegen, wie sie nun in manchen Übersetzungen der Bibel erscheint, wäre hier aus dem Kontext gerissen und fehlplatziert.
Moses und Jesus: sie legten ihre Identität ab um zu dienen
Wir haben vorhin kurz das Bestreben nach einer geistigen Identität der Kirche beschrieben, wie sie in etlichen Konzilen des Vatikan offensichtlich postuliert wird. Ich möchte nun anhand der prophetischen Analogie von Moses und Jesus aufzeigen, wie eine von Gott gegebene Identität gegen die Identität der Welt und der Tradition kämpft. Dazu möchte ich zuerst auf die Familienverhältnisse und die Herkunft von Moses eingehen und im Laufe der Betrachtung auf die Identität zu sprechen kommen, die Gott ihm gab, als er ihm in der Wüste im brennenden Dornbusch erschienen ist.
Und Mose wurde in aller Weisheit der Ägypter gelehrt und war mächtig in Worten und Werken.
Apostelgeschichte 7,22
Ich stellte mir gestern die Frage: wie muss sich Moses eigentlich gefühlt haben, als er vor seinen eigenen Adoptivvater trat, dessen Tochter ihn großgezogen hatte? Er kam mit einer anderen Identität, nicht mehr als Sohn des Pharaoh, nicht mehr als Ägypter, nicht mehr als Mörder, sondern als Vater von Kindern, als Sohn Abrahams, als der Führer von Israel, als Gottes Beauftragter. Hier findet eine Konfrontation mit alten Identitäten statt, die gegen ihn kämpfen. Aber seine Begegnung mit Gott in der Wüste, beim brennenden Busch, ist das was ihm eine neue Identität gibt.
Zieh deine Sandalen aus, denn du stehst auf heiligem Boden.
Exodus 3,5
Er hat Gott gesehen.
Nicht nur das, er kam sogar als Gott zu dem Pharaoh, denn „Der HERR sprach zu Mose: Siehe, ich setze dich zum Gott für den Pharao,“ (Genesis 7,1) und agiert in Gottes Autorität. Wenn man sich außerdem mit der Aussage aus Genesis 46,34 näher beschäftigt, dass Hirten ein Gräuel für die Ägypter waren, wird offensichtlich, was Moses wirklich riskierte und welche Aussage er da machte, als er mit Hirtenstab vor den Pharaoh trat.
Das Symbol des Hirtenstabes
Mose hütete die Schafe und Ziegen seines Schwiegervaters Jitro, des Priesters von Midian.
Exodus 3,1
Ähnlich wie dem Hirtenstab, den Moses mit nach Ägypten nahm, hatte der Pharaoh einen Herrscherstab, so wie auch seine Gehilfen, die Zauberer, denen Moses gegenübertrat.



Den Hirtenstab mit zu nehmen und die Schafe seines Stiefvaters Jethro in Midian dazulassen, mag für die Menschen, die ihn auf seiner langen Reise sahen, sicherlich etwas verrückt erschienen haben. Eine ähnliche Situation hatte der Stammvater Jakob, denn er ging ohne Erbe zu seinem Onkel nach Haran, dem Heimatland seiner Mutter. Moses ohne das Erbe seines Stiefvaters (den Schafherden) nach Ägypten.
Und Mose nahm den Stab Gottes in seine Hand.
Exodus 4:20
Das Symbol des Hirtenstabes ist hier sehr wichtig, denn es war eine Vorschau und göttliche Autorisierung, die Kinder Israels wie eine Schafherde aus Ägypten in ihre Heimat zu führen. Es ist der Hirtenstab von Moses, von außen nicht als der Stab seiner Autorität zu erkennen. Doch die Schrift sagt, es ist der „Stab Gottes“, den er mit nahm.
So spricht
יְהוָה֙ (Yahweh / der Herr),
der Gott Israels: Lass mein Volk ziehen,
Exodus 5,1
Die wahre Identität von Moses liegt im Verborgenen, in dem was man nicht sieht, durch die Anleitung und die Weisheit Gottes, die ihm persönlich zuteil geworden war und die sich in seinen Taten im Auftrag Gottes offenbarte. Vor dem Pharaoh lässt Moses den Stab fallen, was zuerst wie die Unterwerfung eines Hirten vor der Herrschaft des Landes erscheint (so als legte er seine „Waffe“ nieder). Doch dann verwandelt sich der Stab in eine Schlange.
Das Blatt wendet sich.
Plötzlich wird der scheinbare Akt der Unterwerfung eine Bedrohung für den König des Landes und er reagiert mit Krieg (die Stäbe der Zauberer verwandeln sich auch in Schlangen, werden aber von der Schlange von Moses Stab aufgefressen). Auf diesem Wege bestätigen Zeichen und Wunder die wahre Identität von Moses, die geistig und eine Offenbarung Gottes war.
Aaron warf seinen Stab vor dem Pharao und dessen Hofstaat auf den Boden und der Stab verwandelte sich in eine Schlange.
Exodus 7,10
Womöglich überliest man, dass eigentlich Aaron der Bruder von Moses seinem Stab vor den Pharaoh wirft. Doch dies soll hier nur am Rande bemerkt sein, wenn auch darin eine besondere Offenbarung und Erkenntnis verborgen liegt. Durch den Akt des Niederlegens oder Hinwerfens des Symbols der hirtischen Identität von Moses entsteht ein Schauspiel, das als Beweis der Autorität Gottes dient. Das Wunder und das Zeichen wird zu einem Zeugen, vor versammeltem Hofstaat, einem unvergesslichen und unanfechtbaren Zeichen und Zeugen auf Erden.
Gott ist über allen.
Details zum hebräischen Wort für „werfen“ und Nebenbedeutungen
Das interessante an dem hebräischen Wort für „werfen“ shalak (שָׁלַךְ) bedeutet auch „ausreißen“ oder „hinunterstürzen“. Beide Nebenbedeutungen klingen mit in der Geschichte des Auszugs aus Ägypten (das Volk Israel wurde aus Ägypten „herausgerissen“), sowie des Satans, der vom Himmel fiel (Lukas 10,18, Jesaja 14,12, Offenbarung 12:8) oder hinunterstürzte und sich im Garten von Eden den ersten Menschen als Schlange zeigte.

Du führtest dein Volk wie eine Herde durch die Hand von Mose und Aaron.
Psalm 77,21
Ich denke, dass auch in unserer Errettung durch das Blut Jesu und bei der geistigen Neugeburt unsere Identität als Kinder Gottes durch Zeichen und Wunder bestätigen werden darf, nicht in einer äußerlichen Erscheinung von Pontifikalien oder einem theologischen Studienabschluss. Die Taufe (das Wasser), das Blut Christi als himmlische Währung zum Loskauf unserer Seele und der Heilige Geist geben Zeugnis.
Die Konsequenz ist aber dann, dass wir nicht selber Beweise unserer Errettung liefern müssen, sondern Gott selbst sprechen und wirken lassen. Gott kann, wie beim „Volkshirten“ Moses oder dem Stammvater Jakob, unsere alte Identität, die in Schande und Verachtung gehüllt ist, für sich umdeuten und für seinen Rettungsplan gebrauchen. Wenn er dann unsere Errettung bestätigt, da der verlorene Sohn wieder nach Hause zum Vater kommt, ist für jeden unsere Errettung authentisch. Die neue Identität, die wir in Christus haben, zeugt für sich selbst.
Jesus verließ seine Heimat
Aus den oben gefundenen Analogien in der Bibel über Identität und Errettung, können wir ableiten, dass Jesus auf ähnliche Weise wie Moses zum Hause des Pharaoh, als Gott zum Haus Israel kam, obwohl er von einer Frau geboren wurde und ein Mensch war. Zugleich aber war er Gottes Sohn, von ihm gezeugt: sein Vater war im Himmel. Er verließ seine Heimat (den Thon Gottes), verzichtete auf sein himmlisches Erbe, nahm Menschengestalt an und diente uns wie ein Hirte, der seine verlorenen Schafe sucht.
Er entäußerte sich und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist
Philipper 2,7
Wie man sieht, deckt sich die Geschichte von Moses mit dem Evangelium von Jesus und gibt uns sehr viele Hinweise, wie ein Mensch als Gott auftreten kann. Nicht anders ist der Satan vom Himmel gefallen und hat sich als Gott ausgeben: in Form einer Schlange im Garten Eden oder als Pharaoh, der Gott gleich sein wollte („Mir gehört der Nil, ich habe ihn geschaffen!“, Hesekiel 29,9). Die himmlische Rebellion des Engels zog die göttliche Demut des Menschensohnes nach sich.

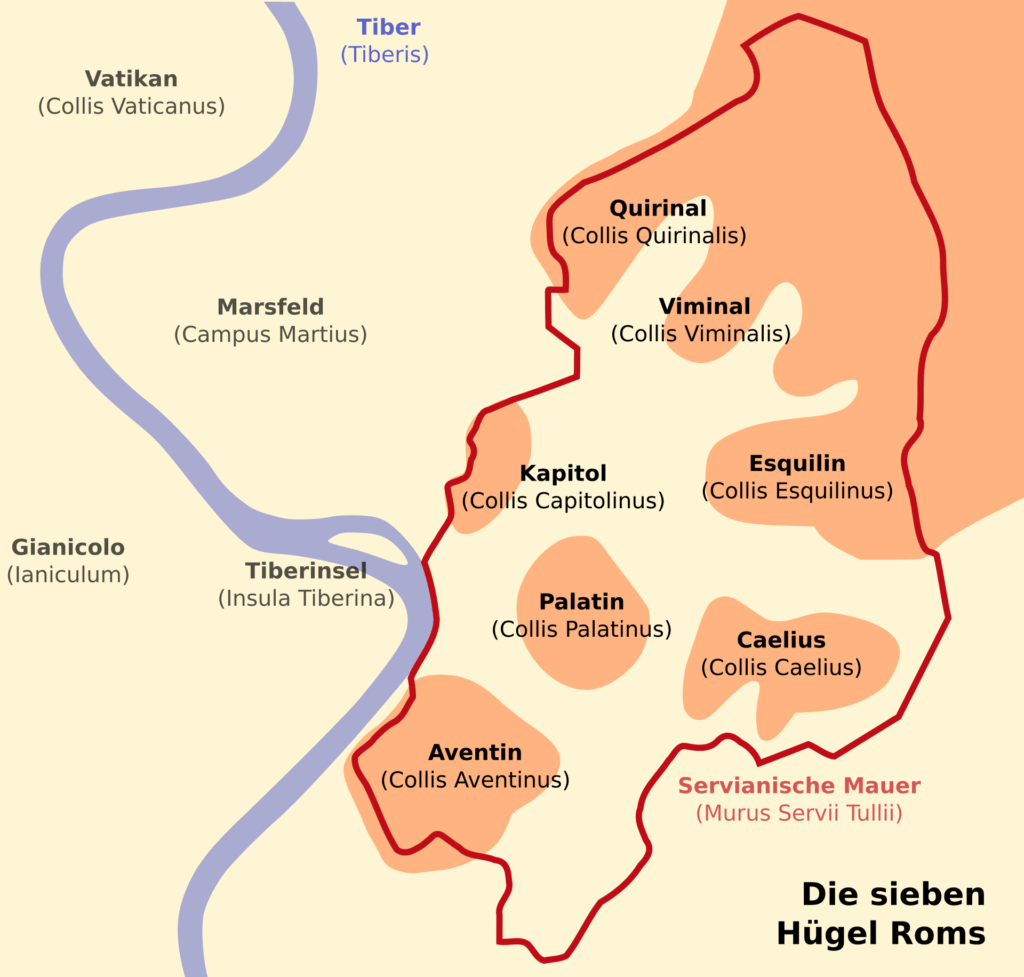
Schluss
Anstatt in der Theologie und Kirchentradition mit deren Dogmen nach Gott zu suchen, sollten wir lieber Gottes Wort allein dazu gebrauchen. Darin liegen alle Geheimnisse und Antworten. Gott kann wunderbar in der heiligen Schrift zu uns reden und uns zeigen, wer er wirklich ist.
Geht hinaus aus ihr, mein Volk, damit ihr nicht ihrer Sünden teilhaftig werdet und damit ihr nicht von ihren Plagen empfangt!
Offenbarung 18,4
Anhand des Krummstabes, den die katholische Kirche für ihre Würdenträger als Merkmal und Symbol göttlicher Autorität beansprucht, sehen wir eigentlich eine offensichtliche Anlehnung an Ägypten, was allein schon ein Gräuel für Gott ist (das Obelisk auf dem Petersplatz in Rom spricht dieselbe Sprache, es zeugt von einem Geist der Sonnenanbetung von Ägypten).
Der Krummstab von Päpsten und Bischöfen steht für nichts anderes als die Herrschaft von Ägypten, die voll Zauberei und Götzendienst ist, den die Kinder Israels mit in die Wüste nahmen. Lasst uns durch die Wüste ziehen und Gott uns von aller Zauberei und Götzendienst bereinigen und befreien.

Amen.

